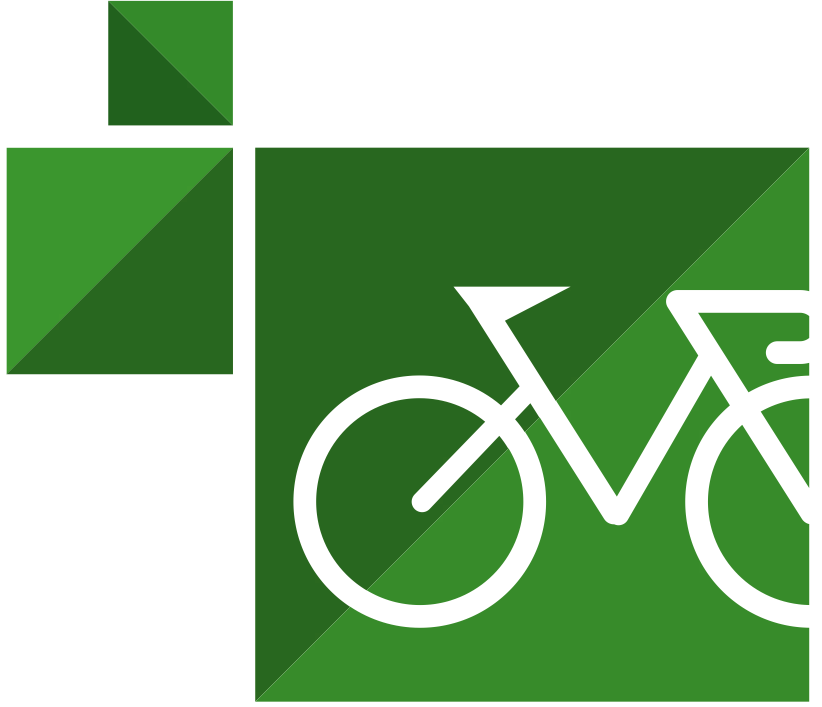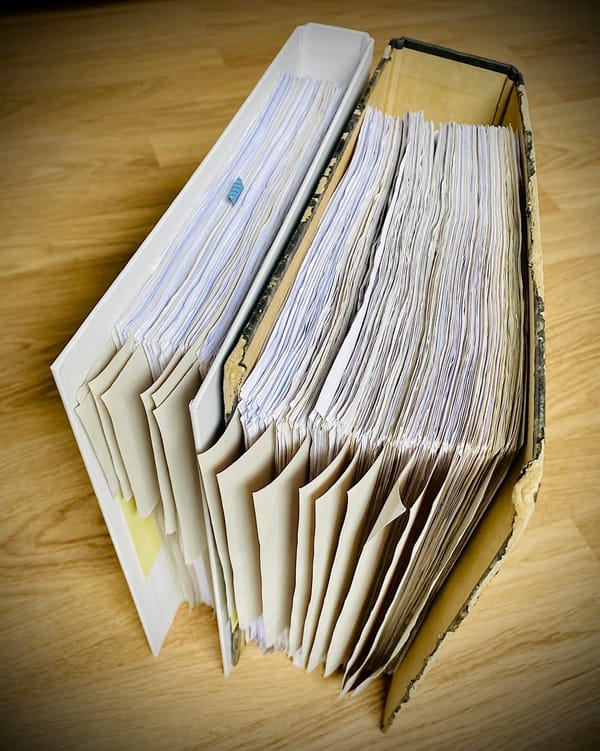Gemeinderat
Ein günstigerer Mängelmelder - ungenutzte Chancen und Potentiale
Nachdem in einer Mannheimer Lokalzeitung darüber berichtet wurde, dass der Mängelmelder Mannheim abgeschaltet werden soll, haben wir uns die Situation genauer angeschaut und eine Open Source Lösung gefunden, die uns nachhaltig beeindruckt hat.